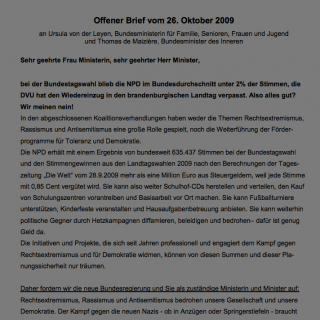Wünscht sich mehr Zivilcourage im ganz alltäglichen Umgang.
Uwe Freyschmidt
Vorsitzender des Berliner Anwaltsvereins e. V.

„Opferschutz ist wichtig!“
Projekte mit Uwe Freyschmidt
Über Uwe Freyschmidt
Zur Person
Im Jahr 1998 wurde Rechtsanwalt Freyschmidt in den Vorstand des Berliner Anwaltsvereins e.V. gewählt, ab 2002 war er dort in der Funktion als 2. Vorsitzender tätig; seit 2016 ist er Vorsitzender des Vereins. Er ist Mitglied in den Arbeitsgemeinschaften Strafrecht, Sportrecht und Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins, der Vereinigung Berliner Strafverteidiger e.V. und der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. (WisteV).
Links